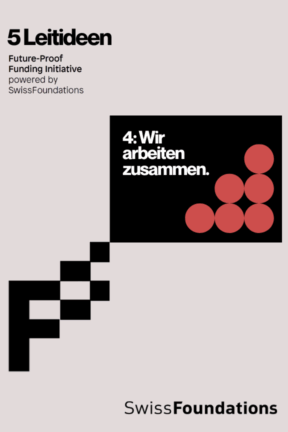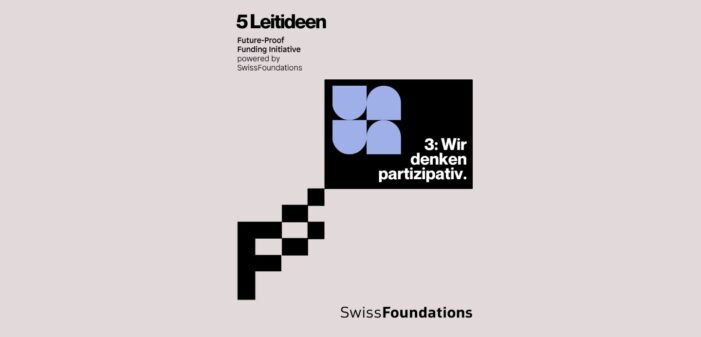
Future-Proof Funding in der Praxis: Ihre Stories zur Leitidee 3 – „Wir denken partizipativ“
Wie sieht Future-Proof Funding in der Praxis aus? Diese Frage haben wir unseren Mitgliedern gestellt und sie eingeladen, ihre Erfahrungen und Beispiele mit uns zu teilen: ob Erfolgsgeschichte, Aha-Moment oder Erkenntnis aus einem gescheiterten Vorhaben. Die Stories zeigen, mit welcher Haltung und welchem Rollenverständnis Stiftungen heute fördern, lernen, kooperieren und sich weiterentwickeln.
Im Fokus dieses Beitrags: Leitidee 3 „Wir denken partizipativ“ der Future-Proof Funding Initiative.
Auf Augenhöhe: Wie Oral Reporting die Fördertätigkeit verändert
SKKG
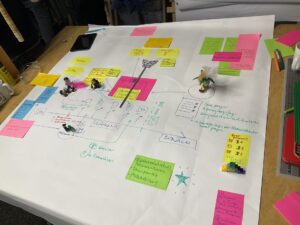 Die SKKG hat Pionierhaftigkeit, Mut zum Risiko und Partnerschaftlichkeit als Werte in der Strategie festgeschrieben. Diese Werte leben wir auch beim Reporting und gehen neue Wege: Anstatt schriftlicher Projektberichte führen wir Gespräche mit unseren Förderungsnehmer:innen, sogenannte «Oral Reportings».
Die SKKG hat Pionierhaftigkeit, Mut zum Risiko und Partnerschaftlichkeit als Werte in der Strategie festgeschrieben. Diese Werte leben wir auch beim Reporting und gehen neue Wege: Anstatt schriftlicher Projektberichte führen wir Gespräche mit unseren Förderungsnehmer:innen, sogenannte «Oral Reportings».
Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Reflexion und Einschätzung über die Erreichung der Projektziele und -wirkungen sowie unserer Zusammenarbeit. Anhand eines Gesprächsleitfadens diskutieren wir in 60 bis 90 Minuten diese Fragen: Wie geht’s? Was lief richtig gut? Welche Herausforderungen haben sie kreativ gemeistert? Was haben sie erreicht und welche Träume warten noch?
Die Vorteile: Erfahrungen werden direkt geteilt, Unklarheiten sofort geklärt, Nachfragen spontan beantwortet. Ganz ohne Papier geht es allerdings nicht, denn die Schlussrechnung muss vorab eingereicht werden. Das bedeutet keinen Mehraufwand, denn diese Zahlen werden ohnehin für die eigene Projektabrechnung und andere Abschlussberichte benötigt.
Oral Reporting ist unser Werkzeug gegen Machtgefälle. Es ermöglicht Austausch auf Augenhöhe, reduziert den Administrationsaufwand und richtet den Blick nach vorn. Die Basis dafür sind echtes Interesse und Wertschätzung für die Arbeit der Förderungsnehmer:innen sowie gegenseitiges Vertrauen. Beide Seiten profitieren davon. Wir werden zu Sparring-Partnern der Museen für ihre neue Projektideen und lernen gleichzeitig für unsere eigene Arbeit mit der Stiftungssammlung.
Neugierig geworden? Eine praktische Arbeitshilfe zur Einführung von Oral Reporting steht öffentlich zur Verfügung und lädt zum Mitmachen ein.
Dass das Konzept funktioniert, zeigt die Gemeinnützige Stiftung Hans A. Bill. Sie hat unsere Arbeitshilfe für ihre Förderungstätigkeit in eine light-Version adaptiert.
Wirkungsmonitoring: aus systematischen Partner:innen-Befragungen lernen
SKKG
 Die Förderung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) orientiert sich in ihrer Strategie an den Werten «Transparenz» und «Partnerschaftlichkeit» und jedes Projekt an gemeinsam definierten Wirkungszielen. Um diese Wirkungsziele zu überprüfen, beauftragt die SKKG externe Evaluator:innen oder entwickelt eigene Messinstrumente.
Die Förderung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) orientiert sich in ihrer Strategie an den Werten «Transparenz» und «Partnerschaftlichkeit» und jedes Projekt an gemeinsam definierten Wirkungszielen. Um diese Wirkungsziele zu überprüfen, beauftragt die SKKG externe Evaluator:innen oder entwickelt eigene Messinstrumente.
Im Frühjahr 2025 führte die Stiftung erstmals eine anonyme, standardisierte Befragung aller geförderten sowie an Förderung interessierten Organisationen durch. Ziel war es, herauszufinden, wie Partner:innen den Gesuchsprozess und die Förderungsphase mit der SKKG erleben. Die Stiftung will verstehen, ob sie ihre selbst formulierten Werte praktisch lebt und wie sie ihre Prozesse verbessern kann.
Die Befragung basierte auf den im Grantee Review Report 2019 festgehaltenen Empfehlungen des Center for Philanthropy Studies (CEPS) und den Vorschlägen, die zu ehrlichem Feedback auf www.backchannel.it zu finden sind. Insgesamt wurden 312 Personen aus drei Kategorien angeschrieben: geförderte Organisationen, nicht-geförderte Organisationen sowie solche, deren Gesuch sich noch in Bearbeitung befand. Die Umfrage war auf Deutsch und Französisch verfügbar und wurde intern ausgewertet.
Die Ergebnisse ermöglichen dem Team der Förderung und den strategischen Gremien der SKKG eine Standortbestimmung des aktuellen Förderungsprozesses. Die Veröffentlichung erfolgt im Verlauf des Jahres 2025 als aggregierter Online-Report.
Systematische Partner:innenbefragungen sind für die SKKG ein Instrument für zukunftsgerichtetes Handeln, da sie systematisches Lernen aus den Erfahrungen der Geförderten ermöglichen und blinde Flecken in der eigenen Förderungstätigkeit aufdecken. Sie ermöglichen es der Stiftung, die eigene Förderpraxis kontinuierlich an die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Destinatär:innen anzupassen und ihre gesellschaftliche Wirksamkeit zu erhöhen.
Die 5 Leitideen sind Teil der Future-Proof Funding Initiative. Wir verstehen sie als Einladung zur internen Diskussion, zur Weiterentwicklung der eigenen Praxis und auch zur kritischen Reflexion des eigenen Selbstverständnisses.
Lesen Sie hier die Stories zur Leitidee 4 „Wir arbeiten zusammen“.
Tags